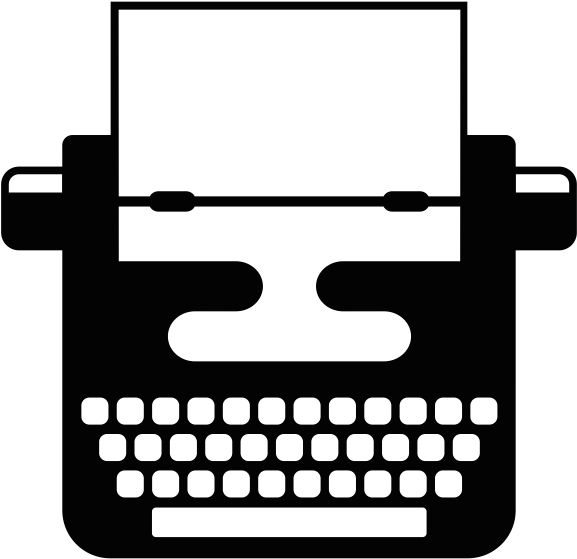Dem Internet gehen die Adressen aus
Das Adresssystem stösst an seine Grenzen. Mit IPv6 gibt es eine Lösung für das Problem, die aber erst zögerlich eingesetzt wird.
Von Matthias Schüssler
Wäre der überwältigende Erfolg des Internets vorauszusehen gewesen, dann hätten seine Väter ein paar Dinge anders gemacht. Beim E-Mail fehlt von jeher ein wirksamer Schutz vor Spam und gefälschten Absendern. Und wie sich jetzt zeigt, war der Vorrat an Internet-Adressen zu knapp bemessen.
Das Internetprotokoll hält 4,3 Milliarden Adressen bereit. Dass das zu wenig sein könnte, war 1974 nicht absehbar. Damals entwickelten Vinton G. Cerf und Robert E. Kahn das Datenaustauschprinzip, das bis heute den Verkehr auf der Datenautobahn regelt. Es teilt jedem Gerät, ob Server oder Surfstation, eine Adresse aus vier Oktetts zu. Jedes Oktett kann 256 unterschiedliche Werte darstellen. Das ergibt einen Adressvorrat, bei dem sich zwei Erdenbürger eine Adresse teilen müssten.
Westliche Internetnutzer beanspruchen aber längst ein halbes Dutzend Adressen oder mehr. Nebst dem Computer hängen auch Server, Mobiltelefone, Drucker, IP-fähige Fernseher und Spielkonsolen am Netz. Ein Trick hat bis jetzt den Kollaps abgewendet. Mit einer raffinierten Technik namens Network Address Translation (NAT), 1994 erfunden, teilen sich die Nutzer in einem Firmennetz oder in einem privaten Heimnetz eine einzige öffentliche Adresse. Innerhalb dieses Netzes hat jeder Teilnehmer eine private Adresse, die gegen aussen nicht sichtbar ist und einmal pro Netz vergeben werden kann. Die Schweizer Mobilfunkbetreiber fangen mit NAT den Mehrbedarf an Adressen ab, den die internetfähigen Smartphones verursachen.
Vorrat in Asien aufgebraucht
Doch auch der Trickserei mit NAT sind Grenzen gesetzt. Der Adressbedarf der Schwellenländer lässt sich auf diese Weise nicht decken. «Man kann nicht ganz Afrika hinter einem NAT verstecken», sagt Willi Huber, der Leiter des Bereichs Network bei der Switch, der Hüterin der Schweizer IP-Adressen. Auch für neue Webangebote braucht es zwingend «richtige» Adressen.
Das Problem hat sich Anfang Jahr verschärft, als im asiatischen Raum die Reserven komplett zur Neige gingen. Wer eine Adresse benötigt, um beispielsweise einen Webserver ans Netz zu bringen, muss seit Februar 2011 darauf warten, dass ein anderer Betreiber eine Adresse an die Vergabestelle zurückgibt. In Europa ist die Situation noch nicht ganz so dramatisch. Hierzulande reichen die Reserven bei den lokalen Vergabestellen noch bis Mitte 2012.
Die Adressknappheit ist ein gewichtiger Nachteil für neue Organisationen oder Unternehmen, die nur mit Glück und Verzögerungen ans Netz kommen. Bereits gibt es Fälle von Schwarzhandel mit ungenutzten Adressen, der zwar verboten ist, aber nicht sanktioniert werden kann. Die Adressknappheit ist auch ein Innovationshemmnis.
Neue Gadgets und Dienste erhöhen den Bedarf erheblich. In der Vision des «Internets der Dinge» hat fast jedes Alltagsobjekt seine IP-Adresse. Doch auch ohne futuristische neue Technologien braucht es mehr Adressen, allein um aufstrebenden Internet-Nationen Chancengleichheit zu gewähren. Den grössten Aufholbedarf haben die Länder Afrikas und Lateinamerikas.
Eine Lösung existiert, ohne dass das Internet neu erfunden werden müsste. Was es braucht, ist ein Adresssystem mit mehr Kapazität. Es existiert seit 15 Jahren und trägt den Namen IPv6. Die Zahl gibt an, dass es sich um die sechste Generation des Systems handelt (die aktuelle Version heisst IPv4). IPv6 verwendet acht Blöcke mit jeweils 16 Bit. Das ermöglicht 340 Sextillionen Adressen – mehr, als es Atome im Universum gibt.
Der unmittelbare Nutzen fehlt
IPv6 ist erprobt und bereits im kleinen Stil im Einsatz, aber noch weit vom Durchbruch entfernt. Die Switch propagiert das neue Adresssystem. Sie will den Unternehmen, den Internetprovidern und den Webnutzern die Angst vor IPv6 nehmen. Die Argumente für den Umstieg: Das neue System lässt sich parallel zum alten nutzen. Ein sogenannter Dual Stack gibt einem Endgerät zwei Adressen. Bei der Datenkommunikation kann es eine IPv6-Adresse verwenden, falls ein Webserver – zum Beispiel google.com – eine solche anbietet. Falls nicht, kommt wie gehabt die IPv4-Adresse zum Einsatz. Die Betriebssysteme Windows, Mac OS X, aber auch iPhones sowie Android-Handys sind gerüstet, ebenso die neusten Webbrowser.
Windows 7 steht allerdings in der Kritik, weil das Betriebssystem die Hardware-Kennung des Netzwerk-Adapters in die IPv6-Adresse einbaut. Dadurch ist ein Gerät im Internet eindeutig identifizierbar: ein aus Datenschutzgründen höchst problematischer Umstand. Beim heutigen System wird die IP-Adresse vom Provider regelmässig neu zugeordnet, sodass keine eindeutige Zuordnung von Adresse und Nutzer möglich ist. Bei IPv6 sind die Reserven fast unendlich, sodass die Notwendigkeit entfällt, Adressen neu zuzuordnen. Weiteres Konfliktpotenzial gibt es bei der Priorisierbarkeit der Daten, die bei IPv6 neu vorgesehen ist. Daten von Bezahldiensten könnten bevorzugt behandelt werden. Das läuft dem Anspruch zuwider, dass im Internet alle Daten gleichberechtigt sind, und birgt die Gefahr, dass kleine Anbieter benachteiligt werden.
Trotz dieser Kritikpunkte ist der Umstieg unvermeidlich, er wird von Providern, Unternehmen und Inhaltsanbietern aber nur zögerlich angegangen. Derzeit nutzen laut einer Statistik von Google gerade 0,3 Prozent IPv6.
Am 8. Juni ist IPv6-Tag
Laut Willi Huber von der Switch war der Druck bislang einfach zu klein. Mit IPv6 lässt sich unmittelbar kein Nutzen erzielen, es gibt aber unmittelbar einen Zusatzaufwand für die Netzwerkverwaltung und die Kommunikationsinfrastruktur. Und die Branche traut IPv6 nicht, weil fehlerhafte konfigurierte Netzwerkknoten irgendwo im Internet dazu führen könnten, dass Anfragen ins Leere laufen.
Der IPv6-Tag soll diese Bedenken zerstreuen. Er findet am 8. Juni dieses Jahres statt. Die Grossen des Internets, namentlich Facebook, Google, Yahoo und Akamai, schalten an diesem Tag ihre IPv6-Adresse frei und warten ab, was passiert. Im Idealfall sind die Probleme so gering, dass der Dual Stack gleich in Betrieb bleibt – und das Internet einen grossen Schritt in Richtung Zukunft macht.
Seine Erfindung wächst und wächst: Internetpionier Robert E. Kahn (mit der Skulptur «Mr. Net»). Foto: Kay Herschelmann (HPI)