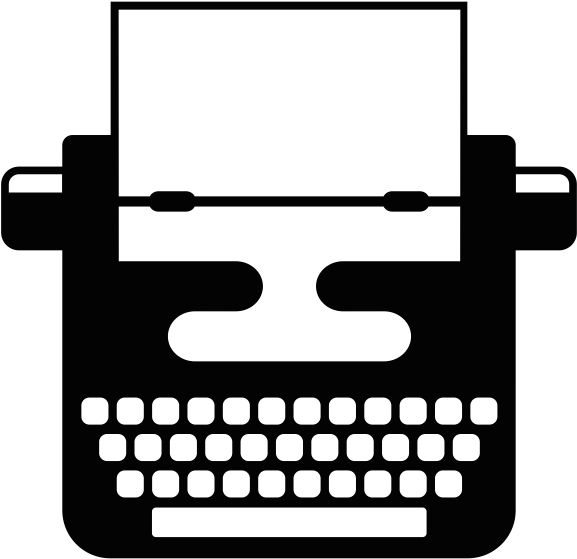«Politisch denkende Menschen verstehen das Anliegen der freien Software»
Matthias Schüssler
Matthias Kirschner, der Präsident der Free Software Foundation Europe, über 30 Jahre freie Software.
Matthias Kirschner, wie hat die freie Software die Welt verändert?
Heutzutage haben Unternehmen Software zur Verfügung, für die sie früher sehr viel Geld hätten bezahlen müssen und mit der sie sich in eine Abhängigkeit begeben hätten. Heute bedienen sich kleine und grosse Unternehmen aus einem Werkzeugkasten von freier Software. Diese Software läuft mittlerweile auf der Mehrzahl der Computer dieser Welt.
Die Idee hat die Welt erobert?
Heute kann ich mir auf meinem Laptop, auf dem Mobiltelefon, Router, Auto, und wo auch immer ein Betriebssystem installieren, das mir die vier Freiheiten gewährt, die Software für jeden Zweck zu verwenden, den Quellcode zu verstehen, zu verbreiten und weiterzugeben. Diese Idee hat funktioniert. Doch seit 1985 hat sich viel verändert. Wir sind bestimmt noch einmal 30 Jahre dabei, um uns um neue Entwicklungen wie «die Cloud», Wearables oder «das Internet der Dinge» zu kümmern.
Ich weiss, dass Richard Stallman den Begriff «Open Source» nicht mag. Ich verwende ihn der Einfachheit halber trotzdem. Open Source findet sich heute bei Android, in den Apple-Produkten, auch bei Microsoft. Haben diese Unternehmen verstanden, was die Idee hinter der freien Software ist?
Die Unternehmen haben verstanden, was freie Software für sie bringt. Den Unternehmen ist es wichtig, dass sie selbst Vorteile haben. Dass die Kunden hinterher auch wieder von den Freiheiten profitieren, ist ihnen etwas weniger wichtig.
Sie haben gesagt, dass Richard Stallman den Begriff «Open Source» nicht mag. Das liegt unter anderem daran, dass der Begriff verschleiert, worum es eigentlich geht. Nämlich um die Freiheit für alle Anwender und nicht nur für ein paar Unternehmen.
Die auf Open Source schwörenden Unternehmen sind also doch nur Trittbrettfahrer?
Die erwähnten Unternehmen – und viele andere auch – profitieren, weil sie nicht mehr so stark von anderen abhängig sind. Sie kontrollieren ihre Technik. Wenn Facebook alle seine Server mit freier Software betreibt, dann hat Facebook die komplette Kontrolle über die Infrastruktur. Da gibt es niemanden, der Facebook an irgendetwas hindern könnte. Die Kunden von Facebook profitieren nicht, weil Facebook keine freie Software weitergibt, sondern nur für sich selbst einsetzt. Ich als Anwender kann bei Facebook nichts ändern, was mich stören würde. Und das ist der Grund, warum Richard Stallman schon früh das Prinzip des Copylefts eingeführt hat.
Dieses Prinzip besagt, dass freie Software, die verändert und weiterentwickelt wird, wiederum für alle freigegeben werden muss.
Genau. Wenn ein Router-Hersteller den Programmkern des Linux-Betriebssystems, den «Kernel», für seine Produkte anpasst, dann kann ich als Nutzer diese Änderungen einsehen und selbst verwenden, weil dieser Kernel eine Copyleft-Lizenz hat. Aber beim Betriebssystem des iPhone ist das nicht der Fall, weil das eben keine Copyleft-Lizenz hat.
Ist es nicht oft so, dass die Copyleft-Lizenz verschwindet, wenn die kommerziellen Unternehmen freie Software verwenden? Auch Android ist nicht unter Copyleft lizenziert.
Das kommt darauf an, welche Teile Sie ansehen: Der Linux-Kernel, auf dem Android basiert, ist weiterhin Copyleft-lizenziert, weil auch Google das nicht ändern darf. Es ist aber schon so, dass die grösseren Unternehmen oft ein Interesse daran haben, ihre Produkte proprietär zu vermarkten. Es gibt aber auch hier unterschiedliche Interessenlagen: Mittelständische Unternehmen in Europa wählen oft eine Copyleft-Lizenz als Investitionsschutz. Sie schützen sich so davor, dass grosse Unternehmen sich ihre Software nehmen, ein paar zusätzliche Funktionen einbauen und als eigenes Produkt herausgeben. An diese Änderungen käme der mittelständische Entwickler nicht mehr heran, wenn die Copyleft-Lizenz nicht genau das gewährleisten würde. Es ist darum nicht so, dass kommerzielle Anbieter immer Nicht-Copyleft und Hobby-Programmierer Copyleft wählen.
Ist es aus Ihrer Sicht ein Vorteil, dass die Entwickler die Wahl haben, ob sie Copyleft miteinbeziehen wollen oder nicht? Oder ist das eine Verwässerung der reinen Lehre?
Das ist eine strategische Entscheidung der Unternehmen. Durch Copyleft ist es schwieriger, freie Software unfrei zu machen. Durch Nicht-Copyleft kann es unter Umständen einfacher sein, eine bestimmte Software weiterzuverbreiten. Die Wahlfreiheit ist eine gute Sache: Viele Unternehmen müssen mit Konkurrenten mithalten, die die eigene Software unfrei anbieten.
Für die freie Softwarebewegung ist es aber natürlich extrem wichtig, dass wir diese Copyleft-Lizenzen haben. Die Lizenz stellt sicher, dass die Rechte Freier Software erhalten bleiben. Die Copyleft-Lizenz zwingt Leute zur Zusammenarbeit, die das am Anfang nicht so wollen. Bis sie merken, dass sie eigentlich davon profitieren.
Die Free Software Foundation Europe bereut also nicht, dass es heute freie Software ohne Copyleft gibt, die sich trotzdem freie Software nennen darf?
Nein. Solange eine Software einem die vier Freiheiten gibt, sie zu jedem Zweck zu verwenden, anhand des Quellcodes zu verstehen, sie weiterzuverbreiten und sie zu verändern, dann ist es freie Software – und das ist immer eine gute Sache für den Anwender. Natürlich bevorzugen wir es, wenn sich ein Entwickler für eine Copyleft-Lizenz entscheidet, weil dadurch sichergestellt ist, dass die Software auch längerfristig frei bleibt.
Um nochmals auf Richard Stallman zu kommen: Ihm ist wichtig, dass es um Freiheit des Anwenders, nicht um Kostenfreiheit geht. Hat diese Unterscheidung heute das Publikum erreicht? Oder denkt die Mehrheit halt doch nach wie vor, dass freie Software diejenige ist, die man kostenlos herunterladen kann?
Es kommt auf die Sprache an: Im englischsprachigen Bereich kann man «free software» auch tatsächlich leicht mit gratis verwechseln. Im Deutschen ist die Unterscheidung etwas einfacher, weil wir frei nicht direkt mit «kostenlos» verbinden. In anderen Sprachen wie Spanisch oder Italienisch ist der Sachverhalt sehr eindeutig.
Und es gibt einen grossen Unterschied zwischen Unternehmen und Privatleuten. Privatleute denken noch oft, es gehe um kostenlose Software. Die Unternehmen haben heute gut verstanden, worum es geht. Nämlich um die Kontrolle über die eigene Infrastruktur.
Und die Politiker?
Sie hinken den Unternehmen hinterher. Doch sie verstehen heute dank den Snowden-Enthüllungen auch besser, was für Auswirkungen es hat, wenn man seine eigene Infrastruktur nicht kontrolliert.
Bei den Anwendern geht es vielleicht mehr um den Emanzipationsgedanken: Will ich mich in die Abhängigkeit eines Softwareanbieters begeben oder die Selbstbestimmung wahren?
Ja. Politisch denkende Menschen verstehen das Anliegen der freien Software. Ich vergleiche das gern mit der Pressefreiheit. Wenn Menschen sagen: «Ich programmiere gar nicht, darum bringt es mir auch nichts, wenn ich die Freiheiten freier Software habe!» Wenn man dann erklärt, dass die Pressefreiheit auch wichtig ist, wenn man selbst keine Zeitung herausgibt oder für Zeitungen schreibt, dann verstehen die meisten, dass es wichtig für eine Gesellschaft ist, dass es dieses Recht gibt. Und dass selbst Leute profitieren, die weder Zeitungsleser sind noch Artikel schreiben.
Ich habe den Eindruck, dass der europäische Ableger der Free Software Foundation eine pragmatischere, etwas weniger ideologische Haltung hat als Richard Stallman. Oder täuscht das?
Ich würde es so sagen: Bei den Zielen stimmen wir komplett überein: Wir wollen eine Gesellschaft, in der jeder Mensch die Möglichkeit hat, seine eigene Technik selbst zu kontrollieren. Nun ist es tatsächlich so, dass Richard Stallman Sie als Journalist darauf hinweist, dass es «GNU Linux» und nicht «Linux» heisst, weil er seit 1983 an dem Gnu-Projekt arbeitet und er sich in seiner Arbeit nicht wertgeschätzt fühlt, wenn man es nach einem Kernel nennt, der erst 1992 geschrieben worden ist. Wir pflegen eine etwas «europäischere» Kommunikation, die mehr auf Konsens ausgerichtet ist. Das geht in Europa gar nicht anders. Das war auch der Grund, weswegen sich die Free Software Foundation Europe gegründet hat. Wir fanden: Die Ziele sind wichtig, aber wir müssen das im hiesigen kulturellen Umfeld ein bisschen anders kommunizieren.
Sie haben es angedeutet: Ihnen geht die Arbeit nicht aus. Was sind die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen?
Wir müssen sicherstellen, dass Menschen weiterhin die Möglichkeit haben, dass Sie ihre eigene Hard- und Software ändern können. Da gibt es mittlerweile viele Einschränkungen. Vielleicht haben Sie von Uefi Secure Boot, Trusted Computing oder Intel Management Engine gehört. Diese Techniken schränken immer mehr ein, was der Anwender auf seinem Computer machen kann und was er installieren darf. Es gibt in manchen Ländern auch rechtliche Einschränkungen, indem man dort die Geräte überhaupt nicht verändern darf.
Wie reagieren Sie auf Entwicklungen wie Cloud Computing und das Internet der Dinge?
Auch das sind riesengrosse Herausforderungen: Können wir Anforderungen definieren, damit wir die Vorteile dieser Entwicklung nutzen können, ohne auf der anderen Seite komplett die Kontrolle über unsere Daten zu verlieren?
Und schliesslich müssen wir sicherstellen, dass Software, die mit öffentlichen Geldern finanziert wird, wieder als freie Software veröffentlicht wird. Es ist für Kommunen und öffentliche Verwaltungen wichtig, dass die nicht immer alles doppelt bezahlen und selbst die Kontrolle über ihre Infrastruktur haben. Aber auch mittelständische Unternehmen sollten die Software bekommen und Anpassungen dafür machen können.
Matthias Kirschner: «Wir pflegen eine etwas <europäischere> Kommunikation, die mehr auf Konsens ausgerichtet ist.»