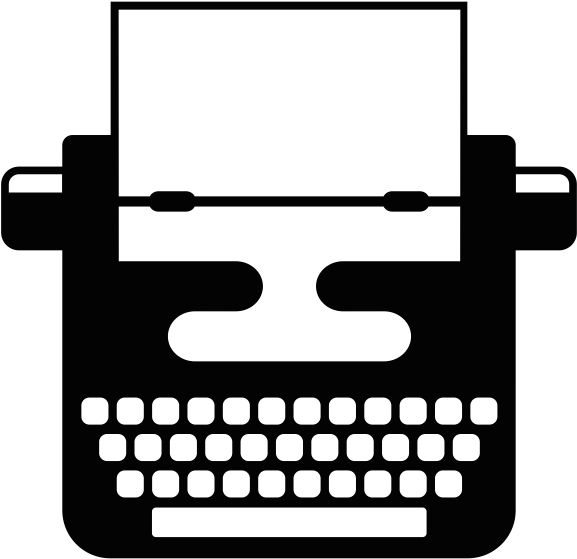Programme zur digitalen Bildgenerierung
Pixelkunst aus dem Elektronenhirn
Die Bearbeitung von Bildern gehört längst zu den Standardaufgaben. Weniger verbreitet ist die digitale Bilderzeugung. Mit Rechenleistung und kostenlosen Programmen erzeugt man synthetische Grafiken, die keinerlei figürliche Qualitäten haben, aber durch geometrische Präzision, abstrakte Dimension und Detailreichtum bestechen.
MATTHIAS SCHÜSSLER Ein Bild, ob digital oder nicht, ist ein Abbild der Wirklichkeit. Am Computer ist diese Wirklichkeit zwar beliebig manipulierbar: Photoshop stellt uns eine ganze Palette an Werkzeugen zur Verfügung, mit denen wir das Abbild der Wirklichkeit beeinflussen. Wir erhöhen den Realitätsbezug, indem wir Bildstörungen entfernen, wir passen die Realität unserer Vorstellung an, indem wir eine hässliche Reklametafel aus dem Foto wegretuschieren, den grauen Himmel blau färben oder stürzende Linien geraderichten. Mitunter verringern wir auch den Realitätsgrad, indem wir den Abstraktionsgrad mit Bildeffekten erhöhen oder viele Motive zu einer digitalen Komposition zusammenfügen – aber die wichtigste Zutat bei der Bildbearbeitung bleiben die Gegenstände des täglichen Lebens beziehungsweise deren Abbild.
Bei der Bilderzeugung per Computer sind Bilder keine Abbilder, sondern das Produkt eines Algorithmus. Eine per Software ausgeführte Konstruktionsmethode, gesteuert von den Vorgaben des Anwenders, resultiert in einer bildlichen Darstellung, die den üblichen Sehgewohnheiten zuwiderläuft.
Es liegt auf der Hand, dass Computer, deren Stärke nicht das Kreative, sondern das Repetitive ist, eine spezielle Art von Bilder generieren. Als Rechenmaschinen sind sie prädestiniert, mit Mustern und geometrischen Formen zu arbeiten. Diese werden in Tausenden oder Millionen Rechendurchgängen wiederholt, abgewandelt, variiert, interferiert oder rückgekoppelt. Computergenerierte Bilder haben eine strenge Struktur. Gleichzeitig wirken sie – dank dem nur durch die unermüdliche Ausdauer eines Siliziumprozessors möglichen Detailreichtum – filigran, elegant und leicht.
Am Anfang war der Apfelmann
Die digitale Bildgenerierung arbeitet mit unterschiedlichen Konstruktionsprinzipien. Jedermann kennt die Fraktale, namentlich das «Apfelmännchen». Es hat eine auf den ersten Blick simple Form aus zwei grösseren, sich berührenden Kreisen und einigen Ausbuchtungen. Bei näherer Betrachtung zeigt sich eine der wesentlichen Merkmale eines Fraktals; die so genannte «Selbstähnlichkeit». Vergrössert man einen Ausschnitt des Randes, erkennt man, dass aus dem Umriss abermals ein Apfelmännchen wächst. Bei jeder Vergrösserungsstufe ist die gleiche Struktur zu erkennen, ad infinitum (beziehungsweise bis zu der Grenze der Berechnungsgenauigkeit). Das Apfelmännchen, das nach seinem Vater auch als Mandelbrot-Menge bezeichnet wird, gilt als formenreichstes geometrisches Gebilde von hohem ästhetischem Reiz.
Die Physik stand Pate
Die Fraktale entpuppten sich als leistungsfähiger Motor für die Bildgenerierung. Eine Reihe von fraktalen Algorithmen erzeugen vielfältigen optischen Output: Bei den iterierten Funktionssystemen (IFS) wird eine Form aus mehreren Kopien seiner selbst gebaut. Lindenmayer-Systeme oder L-Systeme produzieren Strukturen durch rekursive Ersetzung, indem die einzelnen Bestandteile eines einfachen Objekts durch komplexere Bausteine ausgetauscht werden. Die «seltsamen Attraktoren» entstammen der Physik und dem Versuch, komplexe dynamische Prozesse wie Turbulenzen oder Luftströmungen abzubilden.
Andere, nichtfraktale Bildkonstruktionsprinzipien haben ihre Wurzeln in der Biologie. Der Evolutionsalgorithmus lässt Bilder entstehen, indem das «Genom» zweier «Elternbilder» zu einer neuer Generation verschmolzen wird. Das Ergebnis lässt sich über die Parameter wie «Mutationen» beeinflussen. Ein weiteres Prinzip ist der Sprachwissenschaft entlehnt. Mit einer Art «Bilderprogrammiersprache» erzeugt man mit wenigen Zeilen Code komplexe Gebilde. Die «Context Free Design Grammar» (CFDG) geht auf Linguistikprofessor Noam Chomsky zurück.
Bilder des Todes
Programme zur Bildgenerierung stossen nicht immer auf Gegenliebe: «Was du (…) anrichtest, ist noch gar nicht abzuschätzen. (…) Es kommen völlig synthetische Bilder dabei raus, die auch nicht die Spur einer menschlichen Gefühlsaussage haben. Es ist sozusagen die Illustration des Todes, nur alle tun so, als ob sie wunderhübsch sind.» Das schrieb fluuu, ein Anhänger digitaler Kunst, auf dem Forum Art-perfect.de, nachdem eine andere Forumsteilnehmerin meinen im «Tages-Anzeiger» erschienenen Artikel zum Thema zitiert hatte.
Man kann dem Mann seine Empfindung nachfühlen. Computer dringen in so viele Domänen vor und nun sollen sie auch auf den Feld der schönen Künste kreativer sein als ein menschlicher Geist. Natürlich fühlt man sich bedrängt, wenn nun die Elektronenhirne in ein Gebiet einbrechen, in dem man sich bislang halbwegs sicher vor digitaler Vereinnahmung fühlen konnte. Dennoch: Angesichts der Warnung vor den Illustrationen des Todes muss man vermuten, dass fluuu die Programme wohl nicht getestet hat. Sonst hätte er sie locker als Spielzeug für Leute abgetan und sie grosszügig jenen überlassen, die keinen runden Kreis zeichnen können. Wer die Begabung hat, Ideen mit eigener Hand umzusetzen, braucht diese Tools nicht zu fürchten.
Der umgekehrte Weg
Dennoch sind sie nicht überflüssig und nicht bloss Krücken für künstlerisch Minderbemittelte. Mit Digitalkameras, Web- und Handycams schiesst man in allen Lebenslagen Bilder, Bilder und nochmals Bilder. Die Wirklichkeit wird in zunehmendem Mass digitalisiert, und zwar in jeder Lebenslage. Da ist es eine absolute Notwendigkeit, wenn umgekehrt die digitalen Vorgänge im Innern der Elektronikgehirne sichtbare und anschauliche Resultate zeitigen und die Sprache aus Bits und Bytes in neue Formen übersetzt wird. Sowie das Aufkommen der Fotografie die abstrakte Kunst möglich gemacht hat, führen Digicams zu komplett synthetischen Bildwelten.
Programme wie Apophysis, Kandid, Chaoscope und ContextFree sind eine Bereicherung, weil sie es auch den Tüftlern und Programmierern ermöglichen, gestalterisch tätig zu werden. Eine Entwicklung, die man auch bei Technologien wie Flash von Macromedia bzw. Adobe beobachten kann, ebenso bei 3-D-Computergrafik. Oder beim Webdesign, wo man zur Realisierung seiner Gestaltungsideen zunehmend technisches Verständnis braucht. Bei den erwähnten Programmen liegt die Kunst darin, sich von der ungewohnten und meist nicht sehr einleuchtenden Bedienung nicht abschrecken zu lassen und durch ungehemmtes Experimentieren ein Gefühl für zu Pixeln gewordene Algorithmen zu erhalten.
Man kann, wenn man nicht unendlich Zeit für fröhliche Experimente hat, die Programme auch pragmatisch nutzen und ihre sciencefictionhaft oder technoid anmutenden Resultate als Rohmaterial für Photoshop-Kreationen nutzen, sie als Gestaltungselemente verwenden, in Bildkompositionen einbauen oder für hypnotische Videoclips verwenden. Auch Letzeres eine interessante Möglichkeit, angesichts der Animationen, die zum Beispiel Apophysis ausspuckt, wenn man es per Script steuert.
Wenn Computer angeblich «kreative Funktionen» übernehmen, ist Misstrauen angebracht – auch in diesem Fall und bei Apophysis, Kandid, Chaoscope und ContextFree. Sie machen den menschlichen User nicht überflüssig, sondern sind auf ihn angewiesen. Nur mit dem richtigen Input entsteht Ansehnliches. Und es braucht ein menschliches Auge für die Entscheidung, ob ein Werk digitale Kunst oder digitalen Schrott darstellt. Programme zur Bildgenerierung sind ein Werkzeug in der Hand eines fähigen Anwenders. Als neues Genre ist die generative Kunst eine spannende Sache. Und das, obwohl sie noch in den Kinderschuhen steckt.