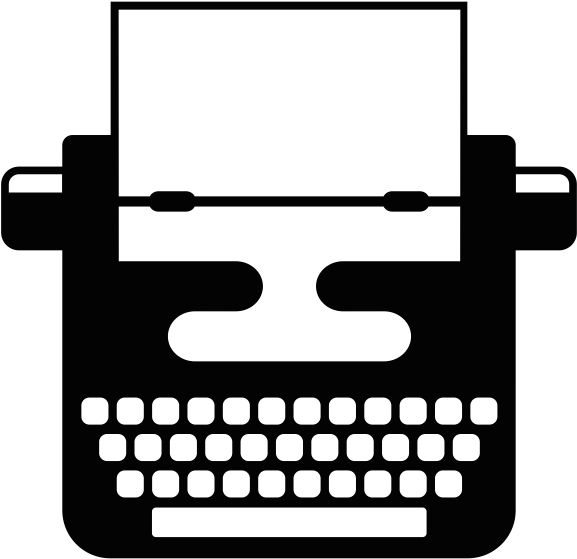In Zürich tobt ein virtueller Mafiakrieg
Das in Zürich entwickelte, populäre iPhone-Game «Gbanga» vermischt Realität und Spielwelt.
Von Matthias Schüssler
In Zürich kämpfen verfeindete Clans um die Vorherrschaft über Restaurants, Banken und Bars. Es geht um Geld und um geografische Vorherrschaft, doch es gibt keinen Frauen- oder Drogenhandel und kein Blutvergiessen. Das Mafiageschäft in «Gbanga Famiglia» wird politisch korrekt betrieben und findet virtuell statt: als iPhone-Spiel, das reale Orte mit einem virtuellen Geschehen verbindet.
«Mixed Reality» nennt sich das und bedeutet, dass man es im Spiel mit Leuten zu tun bekommt, die man wahrscheinlich nicht kennt, die sich aber in der näheren Umgebung aufhalten. Mit ein paar von ihnen tut man sich zu einer «famiglia» zusammen, um Gebiete, im Spiel «Zellen» genannt, zu übernehmen. Je grösser die Mafiasippe, desto mehr Geld und Einfluss versammelt sich, und desto grösser sind die Chancen, den Kampf um eine Zelle zu gewinnen. Die Gebäude, um die der Mafia-Streit tobt, sind ebenfalls der Wirklichkeit entnommen. Das sind vor allem Restaurants und Bars, so das Stauffachertor, der Hallwylerhof oder die Kronenhalle.
Spiel mit Ortsbezug
«Gbanga» ist so gestrickt, dass man zwischendurch spielt: Während einer Zigarettenpause oder, noch besser, wenn man im Tram durch die Stadt fährt. In Zürich, einer der Hochburgen des Spiels, herrscht allenthalben rege Aktivität – in ländlichen Gegenden ist weniger los. Dies versucht die Spiellogik auszugleichen, indem in dünner besiedelten Regionen die Zellen automatisch grösser werden. Dennoch wächst der Spielspass proportional mit der Zahl der Spieler.
Das Spiel ist so gehalten, dass sich ein breites Publikum angesprochen fühlt. Es gibt keine grobe Reibereien, keine Waffen oder Gewalt und nur niedrigprozentigen Alkohol.
Entwickelt wurde «Gbanga» von Matthias Sala und Julio Perez, die mit ihrem Zürcher Start-up-Unternehmen inzwischen sieben Mitarbeiter beschäftigen. Sala kam während eines Forschungsprojekts bei Xerox im kalifornischen Silicon Valley mit geobasierter Werbung in Kontakt und entschied sich, die Idee des geobasierten Spiels «über die drei F: Friends, Fools and Family», zu finanzieren – auch wenn es das Angebot gab, im Auftrag der Werbeindustrie Spiele zu entwickeln oder für eine Bank und eine Versicherung Software zu programmieren. Den eigenen Weg zu gehen, hat Sala nicht bereut, auch wenn die Luft zunehmend dünner wird. Längst haben Gowalla oder Foursquare den Globus mit eigenen standortbezogenen sozialen Netzwerken überzogen, und der Ortsbezug wird bei immer mehr Game-Titeln zum integralen Bestandteil.
Die Konkurrenz wächst also, doch auch das Interesse an der «Gbanga»-Technologie wird grösser. Sich von einem Grossen der Spielbranche aufkaufen zu lassen, käme durchaus infrage – falls es möglich wäre, «als kleines Schweizer Start-up einen Mehrwert zu bieten», sagt Sala.
Heute steckt nebst dem eigenen Geld auch Risikokapital in «Gbanga». Sala setzt bei der Finanzierung auf ein Konzept, das man auch bei vielen mobilen Spielen findet. Wie bei «We Farm» oder «We Rule» ist die App fürs iPhone gratis zu haben. Doch wer vorwärtskommen will, muss mit kostenpflichtigen Gegenständen aufrüsten. Diese gibt es über einen sogenannten In-App-Kauf innerhalb der Anwendung zu erwerben. «Gbanga»-Spieler können ein Polizeimegafon für 1.10 Franken, Bassboxen zur Vergrösserung der «Street Credibility» (11 Franken) oder den «erstklassigen Weltherrschaftssatelliten für 109 Franken» anschaffen.
Arbeiten oder bezahlen
Der besagte Satellit wird pro Woche dreimal gekauft. Sala gibt jedoch nicht preis, wie viele Leute in «Gbanga» unterwegs sind. Die In-App-Käufe seien jedenfalls eine faire Sache: «Entweder erspielt man sich Erfolge, oder man bezahlt.»
Die Kunst bei diesem Modell ist es, die käuflichen Vorteile richtig zu dosieren. Einerseits wollen investitionswillige Spieler ihre Chancen deutlich verbessern. Andererseits dürfen «Freeloader» nicht so sehr benachteiligt werden, dass sie dem Mafiatreiben den Rücken kehren. In «Gbanga» bleiben die Chancen auch für Gratisspieler intakt, indem sie auch gegen hochgerüstete Gegner in einem Übernahmekampf eine zehnprozentige Gewinnchance haben. Selbst der Weltherrschaftssatellit macht finanzkräftige Spieler nicht zu absoluten Dominatoren. Er bringt zwar auf einen Schlag die Herrschaft über 450 Zellen. «Weil der Satellit einen Defekt aufweist, sind die 450 Zellen aber nach dem Zufallsprinzip über den ganzen Globus verteilt», erklärt Sala den Machtausgleich.
Wie viele Spieler Geld ausgeben, und wie viel Geld sie lockermachen, verrät Sala nicht. Er verweist auf die Zahlen vergleichbarer Titel. «Bei Mainstream-Spielen wie ‹Farmville› gibt ein Käufer pro Woche rund 20 Cent aus.» Bei Spielen, in denen ohne Geld nichts läuft, seien es rund 60 Cent. «‹Gbanga› ist bei diesen Zahlen, soweit sich das bis jetzt sagen lässt, hoch mit dabei», sagt Matthias Sala.
Das Finanzierungsmodell polarisiert, vor allem hierzulande. Für die einen sei es «ganz okay», sagt Sala. Sie sehen ein, dass die Plattform finanziert werden muss. Es gebe aber auch Leute, die das als Affront empfänden: «Ihr seid viel zu kommerziell», laute der Vorwurf.
Schlumpfbeeren in der Kritik
In der Kritik steht das In-App-Verkaufsmodell bei Titeln, die Kinder zum Geldausgeben bringen. Das Spiel «Dorf der Schlümpfe» hat die Konsumentenschutzorganisationen auf den Plan gerufen, weil einige Kinder im Spiel für mehr als 5000 Euro «Schlumpfbeeren» eingekauft hatten. Diese Beeren fungieren als Zwischenwährung und sind nötig, um Schlumpfine ein Haus oder Geschenke zu kaufen. Matthias Sala hat auf eine Zwischenwährung verzichtet: «Der Spieler weiss dabei nicht, wie viel er braucht.» «Gbanga» wird auch kaum von Kindern, sondern vielmehr von 20- bis 30- und 50- bis 60-Jährigen gespielt.
Das Game wird weiterentwickelt und soll in nächsten Versionen für neue Spieler leichter zu erschliessen sein. Für die nähere Zukunft sieht Sala Spielwelten vor, die sich über verschiedene Plattformen erstrecken und die nicht nur via Handy, sondern auch am Desktop-PC und an der Spielkonsole zugänglich sind. Und in ferner Zukunft? Da wünscht sich Matthias Sala nichts weniger als die perfekte Verschmelzung von Spiel und Realität – wie bei Michael Douglas im Spielfilm «The Game», bei dem man das eine nicht mehr vom anderen unterscheiden kann.
Matthias Sala hat ein iPhone-Spiel entwickelt, das durchs Labyrinth der eigenen Stadt führt. Foto: Doris Fanconi
Der reale Aufenthaltsort spielt in «Gbanga» eine wichtige Rolle. Screen: TA