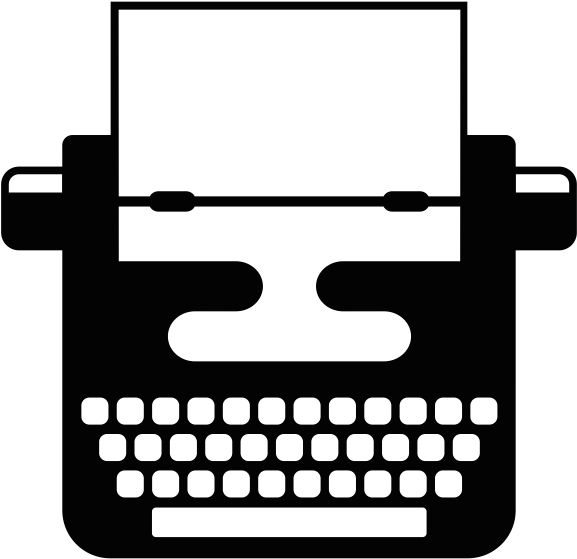Freiheitskämpfer, Rebell und Papst
Ein Porträt von Matthias Schüssler
Richard Stallman kämpft seit 30 Jahren für freie Software. Apple-Nutzer hält er für Narren. Ein Handy hat er nicht, und im Internet surft er nur über das Verschlüsselungsnetzwerk Tor.
Die Welt von Richard Stallman ist die einer dystopischen, faschistoiden Unterdrückungsgesellschaft. Letzte Woche hat er sie in Zürich an einem Referat skizziert: Gerade jetzt soll in der Schweiz ein neues Urheberrecht nach Gusto der Amerikaner implementiert werden, das die Rechte der Anwender auf unfaire Weise beschränkt. Dabei sei «Teilen eine gute Sache». Die Nutzer gängiger Softwareprogramme sind dem willkürlichen Machtmissbrauch der Hersteller schutzlos ausgeliefert. Die Hersteller spionieren die Anwender aus. Es gibt universelle Hintertüren in Betriebssystemen, Mobiltelefonen und digitalen Lesegeräten. Die Hersteller sabotieren die Anwender und drangsalieren sie mit Kopierschutzmechanismen. Die Quintessenz: «Die Hersteller sind gierige Sadisten. Sie verdienen ihr Geld durch Misshandlung der Anwender.»
Richard Stallman hat vor 30 Jahren die Idee, dass Software frei sein muss, institutionalisiert. Er hat die Free Software Foundation gegründet und die passende Lizenzierungsform geschaffen: Anwender dürfen Software frei nutzen, kopieren, im Quellcode einsehen und verändern. Diese Idee hat die Welt geprägt. «Die Welt läuft heute mit freier Software», besagt eine Redewendung: Internetserver, mobile Betriebssysteme, Web-Technologien wären ohne sie nicht denkbar. Doch mir ist Stallmans Sicht zu kompromisslos. In meiner Welt können freie und proprietäre Programme problemlos koexistieren.
Im Gespräch erzählt mir Richard Stallman, wie er auf die Idee der freien Software gekommen ist. Er hat in den 70er-Jahren im Labor für künstliche Intelligenz am MIT gearbeitet. «Ich war Teil einer Software-Sharing-Gemeinschaft.» Der Grosscomputer lief damals mit einem Betriebssystem namens Incompatible Timesharing System (ITM), das den Nutzern Rechenzeit zuwies: «Es war ein System von Hackern für Hacker», sagt Stallman – wobei Hacker natürlich positiv, als kreativer Programmierer zu verstehen ist.
Passwörter gab es nicht
Damals konnten die Studenten ihre Systeme selbst verwalten. Passwörter gab es nicht. Diese basisdemokratische Methode sollte Vorbild sein: «Ich habe vorgeschlagen, in Harvard ein ähnliches System einzurichten, bei dem die Schüler die Regeln bestimmen und lernen, sich zu arrangieren: also nicht Dateien der anderen durcheinanderzubringen.» Dieses Vorhaben ist gescheitert, weil ein Angestellter der Uni sagte, Selbstverwaltung sei wegen Softwareverträgen nicht möglich. Es brauche Reglementierungen und Einschränkungen. «Unser Begriff dafür war Faschismus – und das waren nicht nur meine Worte», sagt Stallman.
Heute werden Computer nicht mehr nur von MIT-Studenten benutzt, sondern von technisch unbeleckten Nutzern. Stallman erzählt die Anekdote, wie ein Professor eine Benutzerverwaltung einführen wollte. Stallman empfand das als unnötige administrative Schikane und füllte über Monate das User-Formular nicht aus. Als der Professor meinte, ohne das Formular könne es passieren, dass sein Benutzerkonto gelöscht werde, parierte er: «Es ist so, dass massgebliche Teile des Systemcodes in meinem Benutzerverzeichnis liegen. Es ist also in Ihrem Interesse, sicherzustellen, dass es nicht gelöscht wird.»
Trotzdem – abseits des MIT-Labors ist in der heutigen Welt eine Benutzerverwaltung wahrscheinlich doch nicht verkehrt, will ich einwenden. Ein Einwand, den Stallman nach wenigen Worten abklemmt: «Hören Sie auf, sich theoretische Beweise auszudenken, warum man die Benutzerverwaltung hätte einführen können. Es ist eine Tatsache, dass die unnötig war», sagt er. Spürbar die Empörung, dass ich vermeintlich mit seinem Professor gemeinsame Sache mache. Und die Lust an der Rebellion. Was ist er? Ein Rebell, ein Idealist, ein Optimist? «Ich habe einfach auf die Anwender gehört.»
Sebst verwendet er einen Laptop mit ausschliesslich freier Software. Er besitzt kein Mobiltelefon, weil er dessen Möglichkeiten der Nachverfolgung scheut. Und alle Websites ausser Wikipedia steuert er nur über das Verschlüsselungsnetzwerk Tor an. Für die meisten Leute ist das nicht praktikabel. «Lebt Ihre Mutter noch? Hat sie einen Computer? Helfen Sie ihr bei der Benutzung?», frage ich. Er bejaht die erste Frage und sagt, jemand in New York würde ihr helfen. Trotzdem – Unerfahrenheit ist für ihn keine Ausrede, auf freie Software zu verzichten, weil die vermeintlich weniger benutzerfreundlich ist. «GNU/Linux ist einfach. Sie müssen nicht die Befehlszeile benutzen. Das System ist in etwa so verschieden von Windows, wie sich die Windows-Versionen untereinander unterscheiden.»
Stallman ist dafür bekannt, während Gesprächen oder Referaten die Schuhe auszuziehen. Auch bei meinem Interview tut er das, um seine Füsse mit Creme zu behandeln. Was mich daran erinnert, ihn nach Steve Jobs zu fragen – der seinerseits, falls die Legende stimmt, seine Füsse durch ein Bad in der Toilette gepflegt haben soll. Stallman findet, Jobs habe mit seinen «iThingies» so verführerische Geräte geschaffen, dass sich die Nutzer gern in den goldenen Käfig begäben, der die Apple-Umgebung darstelle. Was denkt er von den Apple-Kunden? Freiheit bedeutet schliesslich auch die Möglichkeit, sich freiwillig in eine Abhängigkeit zu begeben. «Sie sind Narren. Aber weil es so viele von ihnen gibt, haben sie einen Einfluss auf die Gesellschaft. Und dieser Einfluss ist schädlich.» Er glaube nicht daran, Individuen daran zu hindern, verrückte Dinge zu tun – doch die Gesellschaft müsse so aufgebaut werden, dass es nicht diese Tendenz zur Unvernunft gebe.
«Was lebt im Thunersee?»
Eine überraschende Eigenart von Stallman ist, abrupt die Tonalität zu wechseln. Da hebt er zu Ausführungen zum neuen Schweizer Urheberrecht an, um plötzlich auf Deutsch zu fragen: «Was lebt im Thunersee?» – «Weiss nicht», sage ich. «Der Thunfisch», meint er. «Das würde ich bezweifeln», antworte ich. «Das war ein Witz», sagt er.
Das bringt mich dazu, ihn nach seinem Alter Ego zu fragen, dem heiligen Ignucius – in Anspielung auf sein Betriebssystem GNU –, dem Papst der Kirche von Emacs. Emacs wiederum ist Stallmans Texteditor, der von vielen kultisch verehrt wird. «Ungefähr um 1990 hat mich jemand in der GNU-Mailingliste einen verrückten Imam genannt», erzählt er. «Jemand antwortete: Ja, Emacs ist unsere Religion, Stallman der Papst, und wir beten den Boden an, über den er gegangen ist. Und diese Mailingliste ist unsere Kirche.» Für ihn sei das ein Witz, sagt er, weil Religion oft als Rechtfertigung benutzt werde, um sich keiner ethischen Kritik stellen zu müssen. Doch manche Leute vertreten die freie Software mit religiösem Fieber – auch in der Schweiz, wende ich ein. «Mag sein», sagt er. «Die Idee diskreditiert das nicht.»
Am Ende des Gesprächs würzt Stallman seinen Appell gegen das ungerechte Urheberrecht mit einem guten Schuss «Swissness» – so wie gegen die Habsburger müssten die Eidgenossen heute aufstehen! Ob ein Rückgriff auf die Mythen wirklich der Sache dient? Der Kämpfer für freie Software ist überzeugt: «Wir müssen nicht an Wilhelm Tell glauben, um überzeugt zu sein, dass die Eidgenossen die Adligen immer und immer wieder besiegt haben. Und jetzt ist wieder Zeit zum Kämpfen!»
Video Das Interview mit Richard Stallman in ganzer Länge
stallman.tagesanzeiger.ch
Basisdemokratisch soll die Computerwelt sein: Richard Stallman nutzt auf seinem Laptop nur freie Software. Foto: Doris Fanconi
«Die Hersteller sind gierige Sadisten. Sie verdienen ihr Geld durch Misshandlung der Anwender.»