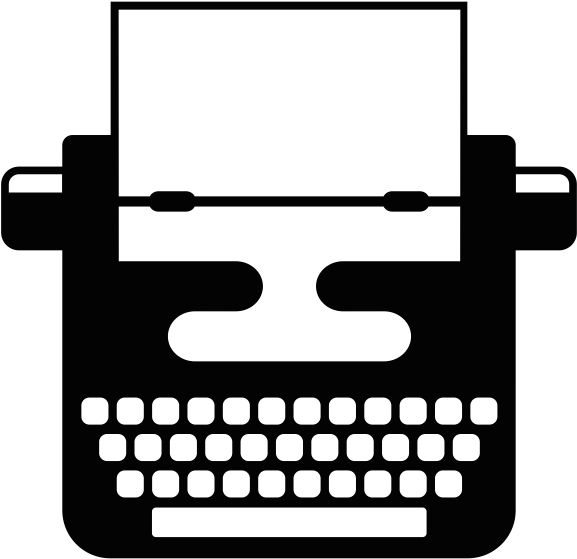«Die Unschuldsvermutung wird umgedreht»
Denis Simonet von der Piratenpartei befürchtet einen Überwachungsstaat. Der Nationalrat debattiert heute Mittwoch über eine Verlängerung der umstrittenen Vorratsdatenspeicherung und den Staatstrojaner.
Mit Denis Simonet sprach Matthias Schüssler
Heute berät der Nationalrat über die Revision des Bundesgesetzes zur Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, kurz Büpf. Vorgesehen ist eine Verlängerung der Vorratsdatenspeicherung von 6 auf 12 Monate. Die Telecomanbieter sammeln präventiv die Verbindungsdaten zu den Teilnehmern von E‑Mail-, Telefon- und Mobilfunkverbindungen. Ausserdem würde die Gesetzesgrundlage für die Govware geschaffen – umgangssprachlich der Staatstrojaner. Er würde in PCs von Verdächtigen eingeschleust, um dort verschlüsselte Kommunikation, etwa via Skype, abzuhören.
Sie wollen das Büpf stoppen, um die Privatsphäre zu retten. Ist die in Zeiten von Google überhaupt noch zu retten?
Selbstverständlich. Wichtig ist: Wir wollen das Gesetz zur Verfolgung von Straftaten nicht abschaffen. Wir wollen, dass es vernünftig umgesetzt wird und nicht alle technischen Mittel ausschöpft, was in letzter Konsequenz zu einem Überwachungsstaat führt.
Was heisst vernünftig?
Es ist ein Aberglaube, wenn man meint, dass man viele Daten sammeln muss, um viele Verbrecher zu fangen. Es gibt Studien, die zeigen: Es gibt keinen Unterschied zu Deutschland, wo die Aufklärungsrate ohne Vorratsdatenspeicherung nicht schlechter ist als in der Schweiz mit Vorratsdatenspeicherung.
Es gibt die Vorratsdatenspeicherung seit 2002. Die meisten merken davon nichts. Sie hat sich bewährt.
Überhaupt nicht! Es geht um unsere Privatsphäre, egal, ob man es merkt oder nicht. Es gibt Verfassungsgerichtsurteile in Deutschland, Österreich und anderen Ländern. Die Richter haben festgestellt, dass die Überwachung dazu geeignet ist, das Verhalten der Leute zu beeinflussen. Man überlegt sich zweimal, ob man von seinen Rechten zur freien Meinungsäusserung Gebrauch macht, weil man ins Raster fallen und sich verdächtig machen könnte. Die Unschuldsvermutung wird umgedreht, wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort ist.
Die Vorratsdaten bringen nichts?
Es gibt keine Studien, die den Nutzen belegen würden. Deswegen darf man so ein Gesetz nicht überhastet einführen. Zuerst müsste die Frage nach der Wirksamkeit gestellt werden, danach braucht es eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Dieses Vorgehen würde ich vom Gesetzgeber immer erwarten, besonders wenn die Grundrechte eingeschränkt werden. Aber das macht der Staat nicht. Es werden noch nicht einmal Zahlen erfasst, wie viele Fälle durch Vorratsdaten aufgeklärt worden sind.
Die Daten seien gemäss Ermittler bei Aufklärungen von Terrorismus, Drogenhandel, Cyberkriminalität, Kinderpornografie und Vermögensdelikten unverzichtbar.
Das ist ein Aberglaube. Dass ein Kinderschänder gefasst werden muss, ist selbstverständlich. Aber das ist auch ohne Vorratsdaten möglich. Ich erwarte, dass die Räte ihre Hausaufgaben machen und die Aufklärungsquote durch die Vorratsdaten abklären.
Für den normalen Bürger ist es einfach: Wer nichts zu verstecken hat, der hat nichts zu befürchten.
Wenn das so wäre, könnte man dem Staat auch alle seine Passwörter im Voraus übergeben, damit die Ermittlungsbehörden im Verdachtsfall auf alle unsere E-Mails zugreifen könnten. Oder würde jemand eine Kopie seines Hausschlüssels abgeben, damit die Behörden im Verdachtsfall die Wohnung durchsuchen können? Solange nichts passiert, wird der Schlüssel nicht benutzt. Aber ich glaube nicht, dass viele Leute so einem Verfahren zustimmen würden. Jeder von uns hat etwas zu verbergen. Wer nichts zu verbergen hat, ist ein langweiliger Mensch.
Haben Sie Ihr persönliches Verhalten im Wissen um die Überwachung verändert?
Nein. Aber ich ertappe mich dabei, dass ich überlege: Wo habe ich meine Daten gespeichert? Was könnte der Staat daraus schliessen? Beziehungsweise: Was könnte mit meinen Daten passieren, wenn ich sie an einem bestimmten Ort speichern würde? Das sind keine schlimmen Dinge . . . aber es ist beängstigend, was Google alles über mich weiss. Was da erst der Staat herausfinden kann!
Auch andere Länder denken über die Vorratsdatenspeicherung nach oder führen sie ein.
Das Büpf macht den gleichen Fehler, wie er in anderen Ländern gemacht worden ist. Der EU-Gerichtshof hat kürzlich die Datenspeicherungsbestimmungen der EU bemängelt. Ein Kritikpunkt war, dass nicht geregelt ist, dass die Daten nach der Mindestfrist gelöscht werden müssen. Zweitens ist nicht geregelt, wie die Daten verwendet werden dürfen. Auch ist keine Sorgfaltspflicht der Anbieter festgeschrieben. Wenn der Gesetzgeber schon Datenschutzbestimmungen aushebelt, dann sollte er wenigstens solche wichtigen Punkte klären.
Die Daten werden nur bei einem dringenden Tatverdacht verwendet, nicht bei Bagatelldelikten.
Das stimmt so nicht. Es gibt einen langen Katalog mit über 70 Straftaten. Einfacher Diebstahl gehört dazu. Doch für mich stellt sich die Frage gar nicht. Die Überwachung findet schon dann statt, wenn die Daten gesammelt werden.
Die Vorratsdatenspeicherung ist wichtig bei der Suche nach Vermissten. Man findet heraus, was sie als Letztes gemacht haben.
Dafür muss man nicht ein halbes Jahr im Voraus Daten speichern. Man kann den Handy- und Internetanbieter anweisen, die Daten ab dem Zeitpunkt zu sammeln, ab dem eine Person als vermisst gemeldet ist. Und übrigens: Auch Anwälte, Ärzte oder Drogenberatungsstellen sind von der Vorratsdatenspeicherung betroffen. Da wird das Berufsgeheimnis ausgehebelt.
Der Inhalt der Kommunikation wird nicht gespeichert, sondern nur die Verbindungsdaten, die Metadaten.
Diese Metadaten verraten, wo wir uns mit unserem Handy gerade befinden. Sie sagen, welche Mails wir an wen verschicken. Das ermöglicht sehr viele Erkenntnisse, wenn man die Daten kombiniert – denn wir kommunizieren den ganzen Tag. Der grüne Nationalrat Balthasar Glättli besitzt seine Daten eines halben Jahres. Das Onlineportal Watson konnte über diese Daten herausfinden, wo sich das neue militärische Rechenzentrum befinden wird, das eigentlich geheim ist. Sie haben seine Daten mit dem Tagesplan der sicherheitspolitischen Kommission abgeglichen.
Zum Büpf gehört auch der Staatstrojaner, der offiziell Govware heisst. Was sind Ihre Einwände?
Der Staat soll nicht auf unseren Computern herumschnüffeln. Es ist unmöglich, eine Software zu schreiben, die Sicherheitslücken ausnützt und den Computer nicht gleichzeitig unsicher macht. Ausserdem ist nicht garantiert, dass der Staatstrojaner nur das tut, was er sollte – und nicht viele andere Dinge auch noch: beispielsweise die Festplatte durchsucht, die Tastatureingaben abfängt, das Mikrofon anzapft.
Cyberkriminelle haben keine Skrupel, alle technischen Mittel für ihre Zwecke auszunutzen. Da gibt der Bundestrojaner den Behörden gleich lange Spiesse.
Es gibt Verbrecher, die grosse Ressourcen zur Verfügung haben, um unethisch zu handeln. Natürlich macht das Angst. Aber nur weil diese Möglichkeit besteht, sollte man nicht überreagieren. Aber im Moment schiesst man sich auf den Bundestrojaner ein – Hauptsache, man sieht, dass der Staat etwas tut. Aber das ist Aktionismus.
Technik-affine Verbrecher kommen ungeschoren davon, weil man sie nicht eruieren kann!
Nein. Verbrechen lassen sich auch ohne Bundestrojaner aufklären. Ich habe nichts dagegen, dass die Daten eines Verbrechers ab einem Verdachtsmoment gespeichert werden – das nennt sich «Quick Freeze». Die Daten von Millionen Menschen in der Schweiz braucht man für gezielte Überwachungen nicht.
Werden Sie das noch aufhalten können?
Ich verspreche mir, dass die Mitglieder der Rechtskommission über die offenen Fragen nachdenken werden. Wir stehen gern zur Verfügung, um alles zu erklären. Vielleicht werden sie zum Schluss kommen, dass das neue Gesetz zwar schön angedacht ist, aber nicht das gewünschte Resultat bringt, und dass man darauf verzichten sollte. Zugunsten unserer Freiheit.
«Es ist unmöglich, eine Software zu schreiben, die Sicherheitslücken ausnützt und den PC nicht unsicher macht.»
Viel Überwachung hilft nicht dabei, viele Verbrecher zu fangen – sagen Gegner der Gesetzesreform. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)
Denis Simonet
Der Softwareentwickler (30) ist Mitglied der Piratenpartei Schweiz, deren erster Präsident er bis 2012 war. Er setzt sich für eine umsichtige Digitalpolitik ein.